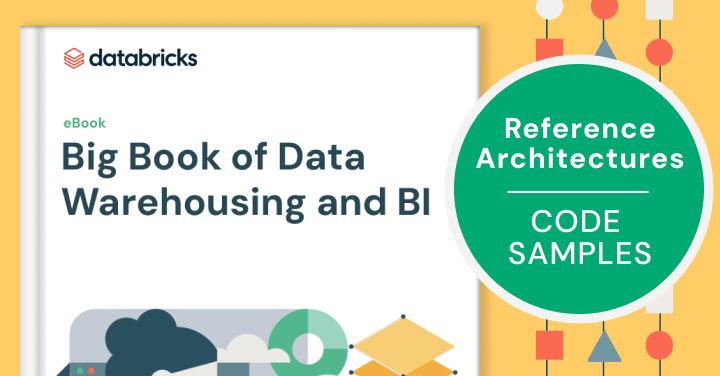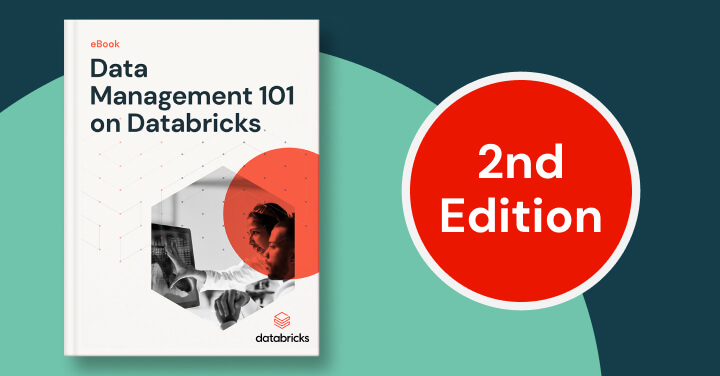Datenmodellierung
Datenmodellierung ist ein zentraler Prozess zur Gestaltung und Organisation von Datenstrukturen, der eine effiziente Speicherung, den Abruf und die Analyse von Informationen unterstützt. Sie ist die architektonische Grundlage für jedes Data-Warehouse-System, und eine effektive Datenmodellierung kann Organisationen helfen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, indem sie die unterschiedlichen Datentypen, die eine Organisation erfasst, analysiert und definiert und die Verbindungen zwischen diesen Datenpunkten und Strukturen veranschaulicht.
Datenmodellierung ist eine strukturierte Darstellung aus verschiedenen Texten, Symbolen und Diagrammen, die zeigt, wie Daten gespeichert, organisiert und abgerufen werden und es einfacher macht, Datenbanken effektiv zu entwerfen und zu verwalten. Ein klares Verständnis des Plans, wie Ihre Organisation mit ihren Daten umgeht und sie analysiert, kann die Gesamteffizienz steigern und Berichte sowie Erkenntnisse beschleunigen.
Was ist Datenmodellierung
Datenmodellierung ist der Prozess, eine strukturierte Darstellung von Daten zu erstellen. Ziel ist es, komplexe Daten zu vereinfachen, indem visuell abgebildet wird, wie verschiedene Elemente zusammenhängen – so lassen sich Datensätze leichter verstehen, verwalten und analysieren. Gute Datenmodellierung hilft, Datenkonsistenz und -qualität durch ein vereinfachtes Datenbankdesign und -management sicherzustellen. Außerdem verschafft Ihnen die Abbildung der Struktur und Organisation Ihrer Daten die Flexibilität, bei Bedarf zu skalieren und Probleme zu beheben – einschließlich Hardwareeinschränkungen, Problemen mit der Netzwerkbandbreite sowie Sicherheits- und Governance-Themen.
Ähnliche Themen erkunden
Konzeptionelles Datenmodell: Dieses Modell konzentriert sich auf übergeordnete Geschäftskonzepte und darauf, wie Daten in einer Organisation genutzt werden. Anstatt technische Details zu erklären, definiert dieses Modell den Umfang eines Datensystems, indem es die Typen und Arten der Daten, die Attribute und die Beziehungen zwischen ihnen identifiziert. Konzeptionelle Datenmodelle vermitteln technischen wie nichttechnischen Zielgruppen ein gemeinsames Verständnis Ihrer Datenlandschaft, helfen, die Lücke zwischen Technik und Fachbereichen zu überbrücken und stärken die teamübergreifende Abstimmung.
Logisches Datenmodell: Dieses Modell baut auf dem konzeptionellen Datenmodell auf, indem es detailliertere und technische Informationen hinzufügt, etwa eine definierte Struktur, die Organisation und die Beziehungen der Daten. Dieses Modell konzentriert sich auf die Darstellung Ihrer Daten und darauf, wie sie logisch organisiert sind, geht jedoch nicht ins Detail, wie diese Daten gespeichert oder abgerufen werden, zum Beispiel in einem Datenbankmanagementsystem oder einer Speichertechnologie. Dieses Modell hilft Designern und Entwicklern, sicherzustellen, dass das endgültige Datenbankdesign sowohl die organisatorischen Ziele als auch die funktionalen Anforderungen des Teams erfüllt.
Physisches Datenmodell: Dies ist eine detaillierte Darstellung, wie Daten in einem bestimmten Datenbankmanagementsystem gespeichert, organisiert und verwaltet werden. Dieses Modell übersetzt das logische Datenmodell in einen technischen Bauplan, um eine lauffähige Datenbank zu erstellen und zu pflegen – etwa in einem SQL Server oder einem anderen Data Warehouse. Das physische Modell optimiert zudem Abfragen durch Indexierung, das Festlegen von Tabellenpartitionierung oder das Angeben von Speicheranforderungen.
Die wichtigsten Bestandteile der Datenmodellierung
Die Datenmodellierung bildet mehrere Schlüsselelemente ab, um die Organisation der Daten innerhalb eines Systems, einer Datenbank oder einer Anwendung nachzuvollziehen.
Entitäten: Entitäten sind reale Objekte oder Konzepte, die Daten enthalten und nachverfolgt werden müssen. Beispiele sind Kundeninformationen, ein Produkt, eine Bestellung oder ein Standort. Entitäten bilden in der Regel das Fundament jedes Datenmodells und sind meist als Tabelle innerhalb einer relationalen Datenbank strukturiert.
Attribute: Das sind die konkreten Merkmale, die eine Entität beschreiben oder definieren. Mit ihnen lassen sich Datensätze gruppieren, filtern oder neu anordnen; weiter zerlegbar sind sie nicht. Wenn eine Entität beispielsweise eines Ihrer Produkte ist, kann ein Attribut die konkrete SKU, die Beschreibung, der Preis oder die Kategorie sein.
Beziehungen: Im Datenmodell sind Beziehungen die Verbindungen zwischen Entitäten und ihren Attributen. Sie helfen sicherzustellen, dass das Modell reale Vorgänge oder Abhängigkeiten zwischen Entitäten korrekt abbildet. Das ist eine zentrale Funktion jedes Modells, um die Datenintegrität zu wahren und Abfragen zu unterstützen, die sich über mehrere Entitäten erstrecken. In der Datenmodellierung gibt es drei Beziehungstypen:
- Eins-zu-eins: Dies wird in einem Datenmodell verwendet, wenn jedes Element einer Entität genau einem Element einer anderen Entität zugeordnet ist. Zum Beispiel kann eine Person eine Eins-zu-eins-Beziehung zu ihrem Führerschein haben.
- 1-zu-n: Dies ist der häufigste Beziehungstyp in der Datenmodellierung und bedeutet, dass eine Entität mehrere Instanzen einer anderen Entität hat. Zum Beispiel kann eine Kunden-Entität mit mehreren Bestellungen verknüpft sein; es kann viele Bestellungen geben, aber sie gehören nur zu einem Kunden.
- Viele-zu-Viele: Dies tritt auf, wenn mehrere Instanzen einer Entität mit mehreren Instanzen einer anderen Entität verknüpft sind. Dies ist der komplexeste Beziehungstyp, und er wird oft in einer Tabelle modelliert, um die Beziehungen zu verfolgen und zu verwalten. Eine Bildungseinrichtung kann dieses Modell verwenden, um Studierende und Kurse nachzuverfolgen; Studierende können sich in viele Kurse einschreiben, während Kurse viele eingeschriebene Studierende haben.
Vorgaben: Damit Datenmodelle präzise, valide und konsistent sind, müssen sie bestimmte Regeln oder Bedingungen zur Speicherung, Verknüpfung und Verarbeitung von Daten einhalten. Zu den häufigsten Arten von Einschränkungen gehören:
- Primärschlüssel identifizieren jeden Datensatz in einer Tabelle eindeutig und verhindern Duplikate.
- Fremdschlüssel stellen die Beziehungen zwischen Tabellen her und erzwingen sie.
- Eindeutige Einschränkungen stellen sicher, dass eine bestimmte Spalte oder eine Spaltenkombination über alle Zeilen hinweg eindeutige Werte enthält.
- NOT NULL-Constraints verlangen, dass bestimmte Felder einen Wert haben; das verhindert unvollständige Dateneinträge.
- CHECK-Constraints helfen, Bedingungen durchzusetzen, die jeder Wert in einer Spalte erfüllen muss.
Zusammen gewährleisten diese Constraints, dass die Datenbankstruktur zu den beabsichtigten Anwendungsfällen in der realen Welt passt und zu aussagekräftigen Analysen führt.
Metadaten: Metadaten sind im Grunde „Daten über Daten“. Metadaten spielen eine entscheidende Rolle für eine wirksame Datenmodellierung, weil sie wichtigen Kontext und Dokumentation zu Ihren Datenstrukturen liefern. Dazu gehören Informationen wie Datendefinitionen, Datenherkunft, Quellsysteme, Aktualisierungsfrequenzen, Kennzahlen zur Datenqualität und Geschäftsregeln, die festlegen, wie Daten interpretiert und genutzt werden sollen. In der Datenmodellierung helfen Metadaten dabei sicherzustellen, dass Entitäten, Attribute und Beziehungen team- und systemübergreifend korrekt dokumentiert und verstanden werden. Es unterstützt zudem Data-Governance-Initiativen, indem es Datenverantwortung, Zugriffsrechte und Compliance-Anforderungen nachverfolgt. Gut verwaltete Metadaten ermöglichen eine bessere Pflege des Modells, erleichtern die Folgenabschätzung bei Änderungen und helfen, Fehlinterpretationen von Datenelementen zu vermeiden. Moderne Datenmodellierungs-Tools enthalten oft Metadaten-Repositories, die diese Informationen automatisch erfassen und pflegen, wodurch leichter nachvollziehbar wird, wie Daten durch Ihre Organisation fließen, und sichergestellt ist, dass Ihre Modelle im Laufe der Zeit genau und nützlich bleiben.
Herausforderungen bei der Datenmodellierung
Datenmodellierung kann eine komplexe Aufgabe sein. Eine der wichtigsten Herausforderungen besteht darin, das passende Datenmodell zu wählen und sicherzustellen, dass es die realen Entitäten und Beziehungen korrekt abbildet. Dafür braucht eine Organisation ein klares Verständnis sowohl der Geschäftsanforderungen als auch der Daten.
Eine weitere häufige Herausforderung ist der Umgang mit Datenkomplexität – besonders bei großen Datensätzen oder Systemen mit mehreren Datenquellen. Die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen führt häufig zu Unstimmigkeiten oder Abweichungen darin, wie die Daten strukturiert oder dargestellt sind. Ein Lakehouse kann einen Teil der Komplexität beim Sammeln und Speichern der Daten mindern, dennoch braucht jedes Modell einen gründlichen Extract, Transform, Load (ETL)-Prozess, um doppelte oder fehlende Daten zu entfernen.
Jedes Datenmodell muss außerdem flexibel sein und auf sich ändernde Geschäftsanforderungen, Markttrends und Technologie-Updates reagieren – bei gleichzeitiger Wahrung der Datenintegrität. Das erfordert laufende Tests und die Wartung von Datensätzen sowie regelmäßige Überprüfungen, um sicherzustellen, dass die Modelle weiterhin mit den übergeordneten Unternehmenszielen und Governance-Standards übereinstimmen.
Modellvermehrung und -verschlechterung: Eine große Herausforderung in traditionellen Datenarchitekturen ist die Vermehrung vieler, voneinander getrennter Datenmodelle über verschiedene Systeme hinweg. Oft landen Organisationen bei getrennten Modellen für ihre ETL-Prozesse, Business-Intelligence-Tools, Data Warehouses und Analyseplattformen – mit uneinheitlichen Definitionen, doppelter Logik und widersprüchlichen Ergebnissen. Mit der Zeit driften diese unterschiedlichen Modelle auseinander, weil verschiedene Teams isoliert Änderungen vornehmen – es entsteht eine fragmentierte Datenlandschaft, in der dieselbe Business-Kennzahl in unterschiedlichen Systemen unterschiedlich berechnet wird. Diese Modellverschlechterung untergräbt das Vertrauen in Daten und erzeugt Wartungsaufwand, weil Teams Mühe haben, mehrere Versionen synchron zu halten. Eine einheitliche Lakehouse-Architektur begegnet dieser Herausforderung mit einem einzigen System, das sowohl Business Intelligence (BI) als auch ETL-Workloads bedient – separate Datenmodelle werden überflüssig. Mit einer einzigen maßgeblichen Quelle der Wahrheit können Organisationen konsistente Geschäftslogik, einheitliche Datendefinitionen und zentrale Governance über alle analytischen Anwendungsfälle hinweg sicherstellen. Dieser Ansatz reduziert nicht nur Komplexität und Wartungskosten, sondern stellt auch sicher, dass Business-Anwender, Data Engineers und Data Scientists mit demselben zugrunde liegenden Datenmodell arbeiten – das sorgt für Abstimmung und Vertrauen in der gesamten Organisation und verkürzt die Zeit bis zu Erkenntnissen.
Datenmodellierung für die Integration von AI und BI
Das Zusammenwachsen von AI und BI hat verändert, wie Organisationen an die Datenmodellierung herangehen. Traditionelle Datenmodelle wurden primär für Reporting und Analytics entwickelt, doch die Integration von AI-Funktionen erfordert einen anspruchsvolleren Ansatz, der sowohl strukturierte BI-Abfragen als auch die komplexen Datenanforderungen von Machine-Learning-(ML)-Algorithmen bedient.
Einheitliche Datenarchitektur für AI/BI: Moderne Datenmodellierung muss den Anforderungen von BI- und AI-Workloads gerecht werden. BI-Systeme benötigen typischerweise stark strukturierte, normalisierte Daten für konsistente Berichte und Dashboards, während AI-Anwendungen oft flexible, merkmalreiche Datensätze brauchen, die sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten verarbeiten können. Ein gut gestaltetes Datenmodell überbrückt diese Lücke, indem es eine einheitliche Architektur schafft, die beide Anwendungsfälle unterstützt, ohne Leistung oder Datenintegrität zu beeinträchtigen.
Feature Engineering und Modellvorbereitung: Datenmodelle in einer AI/BI-Umgebung müssen mit Blick auf Feature Engineering entworfen werden. Dabei geht es nicht nur darum, Daten für klassische Reporting-Dimensionen und -Kennzahlen zu strukturieren, sondern auch darum, aussagekräftige Merkmale (Features) zu erzeugen, die Machine-Learning-Algorithmen nutzen können. Das Modell sollte die Erstellung von Trainingsdatensätzen erleichtern, die Datennormalisierung für ML-Algorithmen unterstützen und eine effiziente Feature-Extraktion ermöglichen – bei gleichzeitiger Wahrung der für das Business Reporting erforderlichen referenziellen Integrität.
Echtzeit- und historische Datenintegration: AI-Anwendungen benötigen oft eine Echtzeitverarbeitung von Daten für prognosebasierte Analysen und automatisierte Entscheidungen, während BI-Systeme historische Daten für Trendanalysen und Leistungsüberwachung benötigen. Datenmodelle müssen so gestaltet sein, dass sie sowohl Batch-Verarbeitung für historische BI-Berichte als auch Stream-Verarbeitung für AI-Vorhersagen in Echtzeit unterstützen. Diese Doppelfunktion stellt sicher, dass Business-Anwender auf klassische Berichte zugreifen können, während Data Scientists Modelle bereitstellen können, die in Echtzeit auf veränderte Bedingungen reagieren.
Governance und Datenherkunft in AI/BI-Workflows: Wenn Daten durch AI- und BI-Pipelines fließen, wird die Aufrechterhaltung der Datengovernance zunehmend komplex. Datenmodelle müssen eine robuste Nachverfolgung der Datenherkunft umfassen, die zeigt, wie Daten von Quellsystemen über Transformationsprozesse bis hin zu BI-Dashboards und zum Training von AI-Modellen fließen. Diese Transparenz ist entscheidend, um die Datenqualität und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und Vertrauen sowohl in traditionelle Geschäftsberichte als auch in AI-gestützte Erkenntnisse aufzubauen.
Die Integration von AI- und BI-Funktionen innerhalb einer einzigen Plattform erfordert anpassungsfähigere und umfassendere Datenmodelle als herkömmliche Ansätze. Diese Modelle müssen das gesamte Spektrum analytischer Anforderungen unterstützen, von beschreibendem Reporting bis zur prädiktiven Modellierung.
Datenmodellierung auf Databricks
Data Warehouse
Traditionelle Datenmodelle nutzen ein Data Warehouse, das für das Speichern und Abfragen aufbereiteter, bereinigter und organisierter Daten strukturiert und optimiert ist. Data Warehouses verarbeiten üblicherweise strukturierte Daten und sind darauf ausgelegt, Datenintegrität und Konsistenz sicherzustellen. Ein weit verbreiteter Ansatz ist das Sternschema. Dieses Designmuster besteht aus einer zentralen Faktentabelle, die von Dimensionstabellen umgeben ist, und ermöglicht effiziente Abfragen und Analysen von Transaktionsdaten. Zentrale Merkmale des Sternschemas sind Faktentabellen und Dimensionstabellen.
Nutzer können in Databricks SQL ein Sternschema umsetzen, indem sie einige dieser bewährten Vorgehensweisen nutzen:
- Verwenden Sie verwaltete Delta Lake-Tabellen sowohl für Fakten- als auch für Dimensionstabellen
- Implementieren Sie Surrogatschlüssel mithilfe von Spalten vom Typ Generated as Identity oder Hash-Werten
- Nutzen Sie Liquid Clustering auf Grundlage häufig gefilterter Attribute, um die Abfrageleistung zu verbessern
- Geeignete Constraints (z. B. Primärschlüssel, Fremdschlüssel) für Datenintegrität und Abfrageoptimierung definieren
- Nutzen Sie Delta Lake Features wie Time Travel für den Zugriff auf historische Daten
- Dokumentieren Sie Tabellen und Spalten mit Kommentaren und Tags, um die Data Governance zu stärken
Databricks SQL nutzt die Lakehouse-Architektur, um eine Vielzahl strukturierter und unstrukturierter Daten zu verarbeiten. Dies bietet eine offene, einheitliche Plattform zum Erfassen, Umwandeln, Abfragen, Visualisieren und Bereitstellen von Daten. Der Hauptvorteil ist, dass Sie verschiedene Clouds, verschiedene Plattformen und verschiedene Formate nutzen können.
ERD und Datenherkunft für eine effektive Datenmodellierung nutzen
Moderne Datenmodellierung erfordert mehr als nur das Verständnis einzelner Tabellen und ihrer Strukturen. Sie verlangt auch einen umfassenden Blick darauf, wie Datenentitäten miteinander in Beziehung stehen und wie Informationen durch Ihre Organisation fließen. Entity-Relationship-Diagramme (ERDs) und Datenherkunft bieten diese ganzheitliche Perspektive und ermöglichen es Datenarchitekten, fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn sie neue Datenmodelle entwerfen oder bestehende optimieren.
ERDs für visuelle Datenarchitektur: ERDs fungieren als visuelle Blaupause Ihrer Datenarchitektur und zeigen die Beziehungen zwischen Primärschlüsseln und Fremdschlüsseln von Tabellen in einem intuitiven Diagrammformat. Diese Diagramme helfen Fachleuten für Datenmodellierung, die bestehende Datenlandschaft zu verstehen, bevor sie neue Strukturen entwerfen, damit neue Modelle mit den etablierten Beziehungen übereinstimmen und die referentielle Integrität gewahrt bleibt. Indem visualisiert wird, wie Entitäten miteinander verbunden sind, zeigen ERDs Muster in der Datennutzung, identifizieren potenzielle Bereiche für Optimierungen und helfen, die Entstehung redundanter oder widersprüchlicher Datenstrukturen zu verhindern.
Datenherkunft als Modellierungsgrundlage: Datenherkunft verfolgt den Weg der Daten von ihrem Ursprung über verschiedene Transformationen bis zu ihrem Ziel und liefert Einblicke, wie Daten durch ein System fließen. Diese Informationen sind bei der Gestaltung von Datenmodellen äußerst wertvoll, weil sie zeigen, welche Datenquellen in bestimmte Tabellen einfließen, wie Daten unterwegs transformiert werden und welche nachgelagerten Systeme von bestimmten Datenstrukturen abhängen. Wer diese Abhängigkeiten versteht, kann fundierte Entscheidungen zu Schemaänderungen treffen, Konsolidierungspotenziale erkennen und sicherstellen, dass neue Modelle bestehende analytische Workflows unterstützen.
Unity Catalog: Zentrale Metadatenverwaltung: Databricks Unity Catalog ist ein umfassendes Metadaten-Repository, das sowohl ERD-Beziehungen als auch Informationen zur Datenherkunft (Data Lineage) automatisch erfasst und pflegt. Über den Catalog Explorer können Nutzende ERDs für beliebige Tabellen mit Fremdschlüssel-Constraints leicht einsehen, Beziehungen auf einen Blick visualisieren und verstehen, wie sich Datenentitäten in ihrer Lakehouse-Architektur verbinden. Dieser zentrale Ansatz der Metadatenverwaltung stellt sicher, dass Entscheidungen zur Datenmodellierung auf vollständigen, aktuellen Informationen über bestehende Datenstrukturen und Abhängigkeiten basieren.
Fundierte Entscheidungen in der Datenmodellierung: Durch die Kombination aus ERD-Visualisierung und umfassender Nachverfolgung der Datenherkunft können Organisationen die Datenmodellierung mit einem vollständigen Verständnis ihres bestehenden Datenökosystems angehen. Dieses Wissen ermöglicht es Modellierenden, Schemata zu entwerfen, die vorhandene Beziehungen nutzen, unnötige Duplikate vermeiden und sicherstellen, dass neue Modelle sich nahtlos in etablierte Datenflüsse integrieren. Das Ergebnis ist eine kohärentere, leichter wartbare Datenarchitektur, die sowohl aktuelle Analyseanforderungen als auch künftiges Wachstum unterstützt.
Dieser integrierte Ansatz für die Datenmodellierung, unterstützt durch die Metadaten-Management-Funktionen von Unity Catalog, verwandelt die Datenmodellierung von einer isolierten Tätigkeit in eine strategische Initiative, die das gesamte Datenökosystem berücksichtigt.
Mit der Databricks Data Intelligence Platform
Databricks SQL ist das intelligente Data Warehouse auf der Databricks Data Intelligence Platform. Das ist ein Paradigmenwechsel im Data Warehousing hin zur Data-Lakehouse-Architektur: Sie vereint die besten Elemente traditioneller Data Warehouses mit der Flexibilität und Skalierbarkeit moderner Cloud-Architektur und ergänzt dies um die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz. Dies erweitert die Möglichkeiten der Databricks Data Intelligence Platform, indem es die Datentransformation und -analyse für eine breite Nutzerschaft erleichtert – von Business-Intelligence-Analysten und Datenarchitekten bis hin zu Dateningenieuren.
Basierend auf dem gut konzipierten Lakehouse können Databricks SQL-Nutzende:
- Daten kuratieren und vertrauenswürdige Daten als Produkt anbieten (DaaP)
- Datensilos beseitigen und Datenbewegung minimieren
- Wertschöpfung durch Self-Service-Erfahrungen demokratisieren
- Eine unternehmensweite Data-Governance-Strategie einführen
- Fördern Sie den Einsatz offener Schnittstellen und offener Formate
- Auf Skalierung auslegen und für Leistung und Kosten optimieren